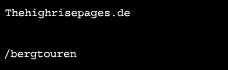Stausee
Mooserboden und Hocheiser
beim Aufstieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus. Stausee
Mooserboden und Hocheiser
beim Aufstieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus.

 Blick beim
weiteren Anstieg zum Großen Wiesbachhorn nahe am Gletschersattel der
Wielingerscharte: Ganz links Vorderer Bratschenkopf, in der
Mitte Hinterer Bratschenkopf, rechts dahinter Klockerin. Blick beim
weiteren Anstieg zum Großen Wiesbachhorn nahe am Gletschersattel der
Wielingerscharte: Ganz links Vorderer Bratschenkopf, in der
Mitte Hinterer Bratschenkopf, rechts dahinter Klockerin.

 Zweiter Tag
beim Anstieg zum Hinteren Bratschenkopf: Hinten die Felspyramide des
Hohen Tenn, rechts, am Fuße der Westflanke des Großen Wiesbachhorn, der
weite Gletschersattel der Wielingerscharte. Zweiter Tag
beim Anstieg zum Hinteren Bratschenkopf: Hinten die Felspyramide des
Hohen Tenn, rechts, am Fuße der Westflanke des Großen Wiesbachhorn, der
weite Gletschersattel der Wielingerscharte.

Am Gipfel des Hinteren Bratschenkopf:
 Großes
Wiesbachhorn mit Westflanke (rechts die Südflanke), Großes
Wiesbachhorn mit Westflanke (rechts die Südflanke),
 Blick nach SSW auf
den Nachbar Klockerin (3419m). Links am Horizont
Großglockner (3798m), darunter Großer Bärenkopf (3401m). Blick nach SSW auf
den Nachbar Klockerin (3419m). Links am Horizont
Großglockner (3798m), darunter Großer Bärenkopf (3401m).


 Großes
Wiesbachhorn aus Norden vom Nachbarn Hoher Tenn. Großes
Wiesbachhorn aus Norden vom Nachbarn Hoher Tenn.

 Ansicht aus
Nordwesten vom Kitzsteinhorn. Diagonal durch
die Bildmitte zieht der Kaindlgrat. Ansicht aus
Nordwesten vom Kitzsteinhorn. Diagonal durch
die Bildmitte zieht der Kaindlgrat.
|
Anfahrt aus Westen über
Mittersill
(hierher von Kitzbühel oder vom Gerlospass), aus Norden
über Saalfelden
und Zell am See, aus Osten über St. Johann i.Pg. nach
Kaprun. Von dort nach Süden ins Kapruner Tal zum Parkhaus
(gratis) am Straßenende beim Kesselfall-Alpenhaus. Weiter per Bus
(und Schrägaufzug) zum Stausee Mooserboden (s.a.
Bing Maps, Wetter bei
weather.com). 1. Tag
Am östlichen Ende der Staumauer nach links, dem Hinweis
„Heinrich-Schwaiger-Haus“ folgen. Wenig höher am nächsten Verzweig rechts
weiter. Der Weg führt nun ohne größere Abwechslung über einen behäbigen,
mittelsteilen Bratschenrücken zur Hütte empor, Passagen über blanke
Felsbänke sind drahtseilgesichert. Zunächst weicht er in die linke Flanke
aus, dann geht es stirnseitig höher und zuletzt wieder mehr in der linken
Flanke bis nach 1:45 die DAV-Hütte erreicht ist.
Großes Wiesbachhorn: Nach der Hütte steigt man, den
Markierungen folgend, weiterhin den selben Bergrücken an. Zunächst nach
links hinüber wo man alsbald eine steile Rinne (I+,
Drahtseil) zu überwinden hat. Rechts darüber geht es über bratschige
Felsbänke weiterhin rasch höher bis man schließlich nach einer zweiten
gesicherten Passage den Felskopf P 3022 (Unterer Fochezkopf)
erreicht und damit am Beginn des eigentlichen Kaindlgrates steht.
Dieser schwingt sich in drei markanten Aufschwüngen bis an den Fuß der
Westflanke empor: Zunächst als breiter Firnrücken hinauf zu P 3165 (Oberer
Fochezkopf), darüber als scharfe Firnschneide, einmal unterbrochen von
einem weiteren Felskopf. Nach 1:30 steht man am
Fuß der hohen Westflanke, rechts dehnt sich der weite Gletschersattel der
Wielingerscharte
aus.
Nun im Firn halb in die zu unterst noch mäßig steile Flanke hinauf queren,
dann je nach Verhältnissen links dem Nordwestgrat oder rechts dem
Südwestgrat, beide mittelsteil, zuwenden. Über beide Grate erreicht man auf
etwa halber Flankenhöhe einen ggf. ausgeaperten, felsigeren Gürtel über den
man in beliebiger Route weiter empor steigt und schließlich über den linken,
steilen Grat, zunächst gut gestufter Fels, zuoberst Firn, den höchsten Punkt
mit Kreuz und Buch erreicht (0:55).
Abstieg zurück zum Gletschersattel in 0:25, zur
Hütte in
1:00.
2. Tag
Hinterer Bratschenkopf: Erneut zum Gletschersattel der
Wielingerscharte wie oben beschrieben (1:30). Nun
jedoch in weitem Bogen und mit etwa 40m Höhenverlust über den ganzen
Gletschersattel (vereinzelt Spalten) nach rechts an den nördlichen Bergfuß
der Bratschenköpfe (0:30). In der mittelsteilen
Schuttflanke den Steigspuren folgend schräg nach links bis fast unter das
Gipfelkreuz hinauf traversieren, dann in der obersten Steilflanke (meist
Firn) geradewegs nach oben zum höchsten Punkt mit Kreuz und Buch (0:55).
Abstieg auf dem Anstiegswege: in 0:25 hinab zum
Flankenfuß,
0:30 zum obersten Kaindlgrat,
0:25 bis Unterer Fochezkopf,
0:25 zur Hütte, 1:05 zum
östlichen Ende der Staumauer, 0:15 zur Busstation
an der Heidnischen Kirche.
- Die Tour führt durch den landschaftlich großartigen
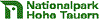 . .
- Das Wiesbachhorn ist nach dem deutlich entfernten
Großglockner
der zweite Hauptgipfel der Glocknergruppe. Er ist technisch formal
unschwierig, oberhalb der Hütte aber über sehr lange Strecken leicht bis
deutlich ausgesetzt. Man bewegt sich fast ausschließlich entweder auf
scharfen Fels- und Firngraten oder in hohen Steilflanken. Auch beim
Hüttenzustieg wird einem keine Erholungsstrecke gewährt.
- Wiesbachhorn alleine begangen.
- Beim Bratschenkopf, der eine kurze, aber nicht ganz harmlose
Gletscherüberschreitung bedingt, ergab sich die Gelegenheit in eine
Zweierseilschaft einbinden zu dürfen. Am Gipfel verlor die Begleitung
wegen des tiefen Schnees jedoch das Interesse, bis zur Klockerin
weiter zu gehen (3422m, hin und zurück etwa weitere 240 Höhenmeter über
eine einfache, sanfte Gletscherflanke). Auch der unmittelbare Nachbar
Vorderer Bratschenkopf
(3400m, über einen ebenen Fels- und Firnrücken bei 17m Gegenanstieg zu
erreichen), konnte nicht mehr reizen, und so ging es zur Hütte zurück.
- Den Bratschenkopf über den felsigen, recht ausgesetzten Nordwestgrat
zu ersteigen ist nicht zu empfehlen. Das Gestein ist über alle Maßen
brüchig.
- Busverkehr Kesselfall-Alpenhaus - Stausee Mooserboden in zwei
Sektionen (unterbrochen durch den technisch sehr interessanten
Lärchwand-Schrägaufzug): 1. Bergfahrt 8:10, letzte Talfahrt 16:45
(Juli und August 17:00).
- Mit Bratschen bezeichnet man die leicht verwitternden
Kalkglimmerschiefer dieser Region.
- Vergl. a. Tour 496, Hoher Tenn, sowie
Tour 704, Hohe Dock.
S. a. Panoramaansichten aus
Nordosten und Osten.
- Wegstrecke (Anstieg Hütte 4.2 Kilometer, Anstieg Großes Wiesbachhorn
2.1 Kilometer, Anstieg Hinterer Bratschenkopf 2.5 Kilometer) zum
Download als GPX-Datei.
Fotos: Thehighrisepages.de |